Kritiken, Reden & Dokumente
George Tabori
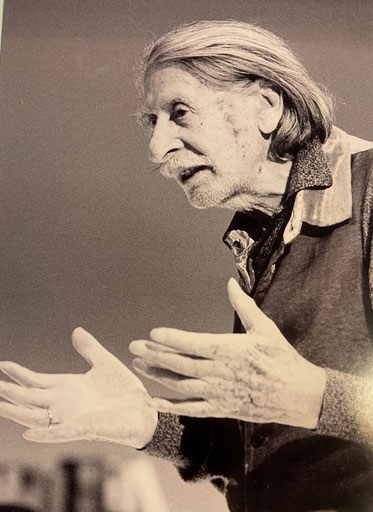
Georg Tabori inszenierte und schrieb bis ins hohe Alter!
Gespräch mit Wend Kässens
11. Juli 2015
Hamburg, bei Wend Kässens zu Hause
Foto #3059 (Aufnahme #2)
WK: Wend Kässens
MSE: Margaret Setje-Eilers
Margaret Setje-Eilers ist Professorin für deutsche Sprache und Kultur an der Vernderbilt University in Nashville, Tennessee.
MSE: Herr Kässens, Sie haben in den letzten Jahren in Deutschland vier frühe Romane aus den 40er Jahren von George Tabori herausgegeben, die seinerzeit in England und in den USA erschienen sind, aber noch nie ins Deutsche übersetzt wurden: Das Opfer von 1945, Gefährten zur linken Hand von 1946, Ein guter Mord von 1947 und Tod in Port Aarif von 1951 – nun alle übertragen von Ursula Grützmacher-Tabori, der vorletzten Frau von George Tabori, die auch die meisten seiner Theaterstücke übersetzt hat. Daneben ist von Ihnen und Jörg W. Gronius ein Essayband mit dem Titel Tabori erschienen und, von Ihnen herausgegeben, der Band Der Spielmacher, Gespräche mit George Tabori. Inszenierungen und Stücke von George Tabori haben Sie als Vorsitzender des Kulturvereins Randlage Eschede in Eschede zur Aufführung gebracht, im Rahmen einer Festspielreihe, die Sie Heide(n)spektakel nannten.
Dazu fallen mir gleich viele Fragen ein. Wie haben Sie George Tabori kennengelernt? Was schätzen Sie an seinen Werken? Und wie kam es dazu, dass er in Eschede an Ihren Festspielen teilnahm und schließlich sogar Ehrenbürger von Eschede wurde?
WK: George hat in den letzten Jahren, fast bis zu seinem Tode, geschrieben und inszeniert. Er starb Juli 2007, da war er 93 Jahre alt. Er schlief manchmal während der Proben ein. Der Dramaturg Hermann Beil war dann der gute Geist, der die Inszenierungen weitergeführt hat. Ich durfte manchmal bei den Proben dabei sein, viele Jahre vorher, in den Zeiten seines Theaters „Der Kreis“ in Wien. George sprach mich eines Tages an, ob ich nicht Lust hätte, in seinem Theater mitzumachen. Er hatte ein vereinnahmendes Wesen und spürte sicher, dass ich vor allem mit dem Kopf arbeite, dass mir das Herz nicht so locker sitzt, wie es George Tabori von sich und seinen Schauspielern erwartete. Vielleicht hat er mich auch ein bisschen aufgezogen, wenn er mich aufforderte: „Wend, komm einfach in meine Gruppe und mach mit.“ So spontan war er. Ich habe mich letztlich dagegen entschieden, weil ich die Lockerheit und die Selbstverständlichkeit der Präsenz auf der Bühne nicht aufbringen konnte - obwohl ich als Student in Hamburg im Straßentheater „Schwarze Katze“ böse Unternehmer gespielt und später, als Dramaturg, gelegentlich kleine Rollen übernommen habe…
MSE: Wann sind Sie zuerst auf George Tabori aufmerksam geworden?
WK: Während der Studentenbewegung. Das war in der großen Zeit der Schaubühne in Berlin Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Da gab es Peter Stein und Claus Peymann mit interessanten Stücken und Inszenierungen, zu denen ich häufiger gefahren bin. Vor diesem Hintergrund tauchte auch Tabori auf, ich habe ihn zum ersten Mal im Fernsehen wahrgenommen, in einer Ausstrahlung seines Stückes Die Kannibalen, das er 1969 zusammen mit Martin Fried in der Werkstatt des Berliner Schillertheaters inszeniert hat. Die hat mich so getroffen und fasziniert, dass ich mich ab dem Moment intensiver mit seinem Werk und ihm befasst habe. Das war eine völlige andere und neue Art von Theater, auch anders als das politische Theater von Peymann, Stein und Jürgen Flimm. Aber nicht weniger intensiv und mindestens genau so brisant! Es war eben nicht Regietheater. Sondern eine stärker auf den Schauspieler zugehende, ihm und dem Theater dienende Regie. Der Schauspieler stand für ihn im Zentrum. Tabori nahm ihre Überforderung durch intensive Proben und die hohe Zahl von Aufführungen ernst. Er sah, wie immer wieder Schauspieler ausfielen oder krank wurden und sich so dem wachsenden ökonomischen Druck, unter dem das Theater schon damals stand, entzogen. Sein Verständnis von Theater und vom Umgang mit den Schauspielern war geprägt durch Stanislawski und Grotowski. Bei Lee Strasberg in New York hat er studiert und inszeniert. Er hatte sich mit der Gestalttherapie von Frederick Perls und dem Psychodrama von Jacob Moreno beschäftigt. All diese Elemente flossen in seine Theaterarbeit, seine Arbeit mit Schauspielern ein. Es war ein therapeutisches Theater, für das die gründliche Einstimmung des Schauspielers durch Konzentrations- und Entspannungsübungen vor jeder Aufführung Voraussetzung war.
MSE: Warum war für Tabori die Verfassung seiner Schauspieler so wichtig?
WK: Der Schauspieler als ein Instrument – das war seine Vorstellung, sein Ideal. So wie der Pianist sich vor dem Konzert einspielt, so schafft der Schauspieler durch Konzentrationsübungen die Voraussetzung für sein Spiel. George sprach davon, dass der Schauspieler seine Existenz und die Rolle, die Verwandlung, in Einklang zu bringen habe. Er darf nicht nur, er muss bei sich bleiben und trotzdem die Rolle verkörpern, „weil man sich selber nicht zu Hause lassen kann. Selbst in einer Rolle ist man der, der man ist. Wenn der Schauspieler nicht bei sich ist, wird er lügen - und das merkt der Zuschauer sofort!“ Alles, was den Schauspieler beschäftigt, im Kopf, im Bauch, in der Seele, trägt eine Aufführung mit! Nur so entsteht Authentizität und eine gewisse Leichtigkeit, die seine Inszenierungen auszeichneten. Dieses ganzheitliche Bewusstsein vom Schauspieler als Individuum und seiner Verwandlung in eine Rolle war dem Regietheater mit seinen oft strengen und hart erarbeiteten Strukturen, die dem Schauspieler mitunter wie ein Korsett übergestülpt wurden, geradezu entgegengesetzt. Mancher auch prominente Schauspieler suchte bei Tabori Hilfe, um dem Stadttheaterstress und dieser Art von Regietheater zu entkommen.
MSE: Was mich sehr erstaunt: dass er Jahre lang in deutschsprachigem Land auf Englisch schrieb und sich auch oft auf Englisch verständigte.
WK: Tabori hat sich viel mit Sprache beschäftigt und auseinandergesetzt. Bevor er nach Deutschland kam hat er viele Jahre in englischsprachigen Ländern gelebt, in London, in Hollywood, in New York. Er sprach sehr viel besser Englisch als Deutsch, schrieb seine Romane, Dramen und Essays auch vorwiegend in Englisch – aber natürlich war Ungarisch die Sprache seiner Herkunft. Als er 1992 als englischsprachiger Autor für seine literarische Arbeit in Deutschland den Büchner-Preis bekam, sorgte das für Irritation. Obwohl er relativ gut Deutsch sprach, schrieb er auf Deutsch erst in seinen letzten Lebensjahren.
Sprachstücke interessierten ihn besonders, er hat ja Gertrude Stein inszeniert. Bei Beckett hat er die Präzision der Sprache gefunden: „Beckett ist schwer zu inszenieren, weil er so ein großer Formalist ist.“ Beckett hat er geliebt, und Brecht! Er hat sich Beckett immer wieder angenähert, seine Beckett-Inszenierungen gehörten zu seinen besten Theaterarbeiten, Warten auf Godot, Endspiel, Verwaiser in München – das waren herausragende Theaterereignisse. Für ihn, der in den USA auch mit Brecht zusammengearbeitet hat, war die persönliche Begegnung mit Beckett das noch größere Ereignis, von dem er immer wieder erzählt hat.
MSE: Wie unterscheidet sich sein Theater von dem seiner Kollegen auf anderen großen deutschsprachigen Bühnen?
WK: Tabori war eine ziemlich einsam dastehende und zugleich einzigartige Figur im deutschen Theater. Er war nicht stilbildend wie Peymann, Bondy oder Zadek, die ihre Adepten fanden. Das Regietheater hat er verachtet. Er sah darin zu viel Selbstdarstellung des Regisseurs und die Domestizierung des Schauspielers, obwohl auch er selbst nicht uneitel war. Seine Inszenierungen waren nie abgeschlossen. Er änderte am Premierentag noch und vermochte es, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der die Schauspieler dazu bereit und in der Lage waren. Das Theater als das Offene, in dem buchstäblich immer alles möglich ist, von der größten Kunst bis zum Scheitern – das entsprach seiner Art zu leben und zu arbeiten. Authentizität war ihm wichtiger als Vollkommenheit. Das hatte er bei Strasberg gelernt, in den USA ausprobiert, im Theaterlabor in Bremen etabliert und später im von ihm umbenannten Schauspielhaus im Theater „Der Kreis“ in Wien fortgesetzt: Der Kreis als Symbol, als graphisches Gebilde ohne Hierarchie, in dem sich alle gleichberechtigt gegenübersitzen – eine Art Menschheitsideal, demokratisch und durch die Achtung des Anderen geprägt. Das war programmatisch für Taboris Theaterarbeit. Die Katakomben haben ihn mehr angezogen als die Kathedralen, wie er das selber mal genannt hat. Sein Theater kam eher vom Experiment, von der Improvisation, als vom fertigen Stück.
All dies hat mich fasziniert, mitgerissen und schließlich dazu geführt, dass ich ihn einlud, mit seinem jeweiligen Theater zu den kleinen Festivals in die Südheide nach Eschede zu kommen. Ihn dafür zu gewinnen war wider Erwarten ganz leicht. Er war für alles zu haben, was besonders, eigen, fremd und nicht Mainstream war. So kam es, dass er 1989 erstmals mit seinem Wiener Theater „Der Kreis“ am sogenannten „Heide(n)spektakel“ teilnahm, einem Festival, das Freunde, der Kulturverein „Randlage Eschede“, die Arno-Schmidt-Stiftung aus Bargfeld, meine Frau und ich ins Leben gerufen hatten.
MSE: Wann haben Sie George Tabori persönlich kennengelernt? Das war doch lange vor Ihrer Einladung nach Eschede.
WK: Das müsste in den siebziger Jahre gewesen sein. Ich war Dramaturg am Hamburger Schauspielhaus bei Ivan Nagel und bin 1978 nach Frankfurt umgezogen, um dort bei Suhrkamp im Theaterverlag zu arbeiten. Spätestens da hatte ich mit George zu tun, Beckett und Brecht waren Suhrkamp-Autoren. Dadurch kam es zu persönlichen Begegnungen und einem Kontakt, der bis zu seinem Tod angedauert hat.
MSE: Das war unmittelbar nach Taboris Bremer Zeit mit seinem Theaterlabor im „Concordia“.
WK: Ja, er war von 1975 bis 1978 mit seinem Ensemble in Bremen.
MSE: Ich bin neugierig, mehr über Eschede und das Heide(n)spektakel zu erfahren. Wie haben Sie es geschafft, dort auf dem Land hochrangige Kunstfestspiele zu etablieren?
WK: Ich habe es nicht allein geschafft! Eschede ist ein kleines, zersiedeltes Dorf mit zahlreichen Ortsteilen in der Nachbarschaft von Celle, oft nur aus wenigen Bauernhöfen und Gesindehäusern bestehend – zu einer sogenannten Samtgemeinde vereint. Wir wohnten im schönsten Ortsteil, in Marwede mit 4 Bauernhöfen und vielleicht knapp hundert Einwohnern. Hier endet die kleine Dorfstraße mitten im Wald, dessen Fläche bis Uelzen und Gifhorn reicht, die größte geschlossene Waldfläche in Norddeutschland. Eschede ist der zentrale Ort mit einem kleinen Bahnhof, den Ortskern teilt eine vielbefahrene Bundesstraße in zwei Hälften. Der Ort hat zweimal negative Berühmtheit erlangt – durch den großen Heidebrand im August 1975, und durch das größte Eisenbahnunglück in Deutschland mit über hundert Toten im Jahr 1998.
Als ich zum NDR kam, Januar 1981, suchten wir ein ruhiges Domizil, wo man seine Ruhe haben und unser damals noch sehr kleiner Sohn auf dem Land aufwachsen konnte – das haben wir in Marwede in einem Gesindehaus gefunden, das wir haben ausbauen lassen. Dann wurde uns schnell klar, dass wir uns dort selbst um Kultur zu kümmern haben, wenn wir dort leben wollen. Auf die Weise ist ein Verein entstanden, den wir angesichts der randständigen Lage in Deutschland, am Rand der Lüneburger Heide und damals noch nahe der DDR-Grenze, „Randlage Eschede“ nannten, was uns in der Bevölkerung nicht nur Zustimmung eintrug. Randlage wollte man nicht sein. Als Understatement konnte man es nicht verstehen. Aber es war dennoch eine Erfolgsgeschichte. An dem Verein beteiligte sich auch die Arno Schmidt Stiftung aus dem benachbarten Bargfeld – es war ein kleiner Verein mit vielleicht 15 Aktiven. Wir haben mit Lesungen und Vorträgen bekannter Autoren begonnen, haben kleine erste Ausstellungen in den drei Etagen der örtlichen, stillgelegten Windmühle organisiert und peu á peu Musiker und Theater eingeladen, die zunächst noch in der „Musenmöhl“ auftraten, einem für diese Zwecke ausgebauten Saal mit rund 100 Plätzen, der ursprünglich ein Teil des Mühlengebäudes war. Es kam dann bald ein Förderverein im Raum Celle dazu, der schnell sehr viel mehr Mitglieder hatte, Celler Unternehmer an der Spitze, und uns nach Kräften finanzielle unterstützte. Celle ist die nächstgelegene Stadt mit siebzig, achtzigtausend Einwohnern und einem kleinen barocken Theater im Schloss. Viele Bürger in Celle begrüßten unsere Aktivitäten in unmittelbarer Nachbarschaft. Nach den ersten, gut besuchten Veranstaltungen dachten wir über ein kleines Festival nach, für das wir den Titel „Heide(n)spektakel“ erfanden. Die Mehrdeutigkeit des Wortes „Heide(n)spektakel“ war eine Reminiszenz an den Schriftsteller und Sprach-Künstler Arno Schmidt, der im benachbarten Bargfeld gelebt hat. Ein Festival im Geiste Arno Schmidts, der 1979 in Celle verstorben war, das war die Idee – für alle Künste, kunstübergreifend, vielschichtig, offen, ideenreich, mit Ur- und Erstaufführungen und möglichst in einer Qualität, die nicht nur in der ländlichen Provinz Bestand haben sollte. Mit Arno Schmidt, dem das erste Festival 1986 gewidmet war, und George Tabori, später, war bundesweite Aufmerksamkeit garantiert.
MSE: In einer Windmühle in Eschede angefangen? Wie ging es weiter?
WK: Zur Mühle und zur „Musenmöhl“ kam mit dem Erfolg bald auch die zur Mehrzweckhalle umgebaute Turnhalle der Schule und schließlich, für Konzerte und größere Theateraufführungen, auch die örtlichen Sporthalle als Veranstaltungsort hinzu. Das viertägig geplante „Heide(n)spektakel“ für alle Künste sollte schon aus Kostengründen nur alle paar Jahre stattfinden. Daneben gab es kleinere Festivals, „hören & sehen“ – und fast im monatlichen Rhythmus Veranstaltungen aus allen Künsten: Jazzkonzerte, Theateraufführungen, Diskussionsrunden, Lesungen, Ausstellungen, Orgelkonzerte, klassische und moderne Musik usw. Insgesamt haben wir bis zur Auflösung des Vereins 2009 vier „Heide(n)spektakel“ durchgeführt, mehrere Kulturwochenenden unter dem Titel „hören & sehen“ und über 200 Einzelveranstaltungen.
Das erste Heide(n)spektakel fand 1986 noch ohne George Tabori statt und wurde wesentlich von der Arno Schmidt Stiftung mitfinanziert. Da gab es herausragend die Uraufführung eines Rundfunkdialogs von Arno Schmidt als Theaterstück, „Der Vogelhändler von Imst“, nach einem Roman von Karl Spindler. Der Text war mit Regiebemerkungen versehen, so dass man davon ausgehen durfte, dass Arno Schmidt eine Aufführung in seine Überlegungen einbezogen hatte. Günter Krämers Bremer Theater war bereit, die Inszenierung zu besorgen und nach der Uraufführung in Eschede auch in Bremen zu zeigen. Weitere Höhepunkte waren die Uraufführung einer John Cage-Komposition durch die Schweizer Pianistin Marianne Schröder; eine Ausstellung der Malerin und Grafikerin Gisela Andersch; und die legendäre Jazz- und Lyrik-Formation Rühmkorf, Naura und Schlüter.
Beim zweiten Festival 1989 war dann George Tabori dabei mit gleich vier Veranstaltungen. Mit der Shakespeare-Collage Verliebte und Verrückte, die er aus Wien, seinem Theater „Der Kreis“, mitgebracht hat, u.a. mit Leslie Malton, Ursula Höpfner-Tabori, Silvia Fenz, Detlef Jacobsen, George Tabori selbst als Shylock im Kaufmann von Venedig an der Seite von Hildegard Schmahl, die die Portia spielte. Die Szenen aus 14 Shakespeare-Stücken, in Wien für zwei lange Abende konzipiert, wurden in Eschede in einer langen Nacht aufgeführt. Die Aufführung begann in der Turnhalle um Mitternacht und dauerte, mit zwei Pausen, bis 8 Uhr morgens. Drinnen gab es Holzbänke ohne Lehne, draußen Buden zur Versorgung des Publikums mit Essen und Getränken. Am Ende lugte durch die Glassteine der Halle die Morgensonne, Ursula Höpfner-Tabori als Rosalinde aus Wie es Euch gefällt gab den fulminanten Monolog über die Liebe und das Spiel zwischen Männern und Frauen. Danach war nur noch Jubel des Publikums, 20 Minuten lang. Und das Gefühl, das Glück, eine unglaubliche Theaternacht erlebt zu haben.
Das zweite Stück war Taboris „Bericht“ Masada, nach Flavius Josephus‘ „Der jüdische Krieg“, mit den beiden Theaterstars Michael Degen, der schon 1969 in der Erstaufführung der Kannibalen die Hauptrolle gespielt hat, und Hildegard Schmahl. Auch das vor restlos ausverkaufter Halle. Schließlich kam noch dazu Taboris 1981 mit dem großen Preis der Stadt Mannheim ausgezeichneter Film Frohes Fest, eine Weihnachtsgroteske - und natürlich eine Lesung aus Taboris Essays.
Weitere Highlights: Ein Jazzkonzert mit Michel Portal, moderne Kammermusik mit dem Ensemble Köln und Robert H.P. Platz, eine Rock-Show mit Georg Ringsgwandel & Band, „Text-Musik-Aktion“ mit Gerhard Rühm, eine Ausstellung der Ölbilder von Robert Gernhard usw.
Zum dritten Heide(n)spektakel im Juni 1992 kam Tabori mit seiner Inszenierung, dem Kafka-Projekt Unruhige Träume aus dem Wiener Akademietheater, dem kleinen Haus des Burgtheaters. Man kam mit dem Flugzeug aus Wien in Hannover an, neun Schauspieler waren beteiligt – es stiegen über 30 Personen aus und in den von uns bereitgestellten Bus ein, Schauspieler, Techniker für Bühnenaufbau und Beleuchtung, Maskenbildner und Umkleidepersonal, nicht zuletzt die Betriebsdirektion. Als alle in Eschede mitten im Dorf vor der Windmühle standen und darauf warteten, wie und wo es weitergehen sollte, kam die Burgtheater-Betriebsdirektorin auf mich zu mit der Bitte, die Unterkünfte sehen zu dürfen. Ein verständlicher Wunsch… Es gibt in Eschede einen einzigen Gasthof mit 8 Zimmern. Natürlich hatten wir alle Zimmer gebucht, die in der Region auf den Bauernhöfen, in den Gasthäusern und privat zur Verfügung standen. Einige davon wollte sie gerne sehen. Der kurze Rundblick war ein Desaster! „Um Gottes Willen, Herr Kässens“ kam sie auf mich zu, „wir wohnen generell in Fünf-Sterne-Hotels. Sie können uns doch nicht in Zimmern mit schrägen Wänden und der Toilette auf dem Flur unterbringen.“ Da sprang dann George Tabori, der damals schon 78 Jahre alt war, in die Bresche und verkündete laut, dass er kein Problem damit habe, in der Schule auf einer Luftmatratze zu übernachten. Er hatte mich schon vorher geimpft und gewarnt: „Du musst fragen, wer denn tatsächlich in einem Luxushotel übernachten muss, aber dann natürlich nur zu den Aufführungen beim Festival sein kann. Und damit drohen, dass, wenn man sich nicht einigen könne, nur der direkte Rückflug bliebe.“ Das war typisch George! Zumal das Burgtheater für den Flug in Vorleistung gegangen war und wir als Veranstalter noch nichts hatten bezahlen müssen. Schließlich war klar: Nur die Techniker bestanden auf dem Hotel, wurden mit Bussen 30 km in die Diaspora gefahren und erstklassig untergebracht, mit Getränken in der Minibar, aber ganz ohne Anbindung an die Ereignisse in Eschede. Die Schauspieler und die anderen Begleitpersonen einschließlich Tabori wählten das „Abenteuer Südheide“, die oft unentgeltlich überlassenen Zimmer in den Bauernhöfen und Privathäusern, dazu stellten wir Fahrräder und einen Fahrdienst zwischen Eschede und den Quartieren zur Verfügung. Die Schauspieler waren begeistert. Das Festival in Eschede konnten auch sie genießen. Und die Technik hat es sich trotz der Verbannung in die luxuriöse Einöde nicht nehmen lassen, mit riesigen Stoffbahnen und mitgebrachten Scheinwerferanlagen die Sporthalle in ein veritables Theater zu verwandeln, in dem auch Therese Affolter, Günter Einbrodt, David Hirsch oder Peter Radtke sich wohlfühlen konnten.
Weitere Höhepunkte 1992: Die Stuttgarter Malerin, Bildhauerin und Bühnenbildnerin und Ausstatterin eines „Rings“ in Bayreuth, Rosalie, verwandelte einen Kuhstall in einen Kunstraum; Helge Schneider & Band überlebten den Zusammenbruch einer Zuschauertribüne; das NDR-Rundfunkorchester spielte die für Eschede komponierte 6. Sinfonie des in Tel Aviv lebenden Komponisten Josef Tal; der Cellist Siegfried Palm spielte die Uraufführung einer Komposition von Dimitri Terzakis; und Kenny Wheelers Jazzband brachte den Saal zum Kochen.
Im Herbst des Jahres 1992 wurde George Tabori mit dem Büchner-Preis ausgezeichnet. Wolf Biermann, der vorgesehene Laudator, nahm die Chance beim Schopfe, kam aus Hamburg nach Eschede um Tabori zu treffen – und bereicherte auch uneingeladen das Festival.
Für eine weitere Überraschung sorgte George selbst, als er uns jetzt erst wissen ließ, dass hinter seinem Engagement in Eschede ein Geheimnis liegt. Seine letzte, 35 Jahre jüngere Frau, Uschi Höpfner-Tabori, ehemals Tänzerin am Bremer Theater, dann in großen Rollen in Taboris diversen Ensembles als Schauspielerin mitwirkend und bis heute am Berliner Ensemble engagiert, hat in Eschede ihre Kindheit verbracht. Mit der Shakespeare-Collage Verliebte und Verrückte, in der sie gleich mehrere große Rollen spielte, war sie 1989 mit ihrem Mann erstmals wieder an den Ort ihrer Kindheit zurückgekehrt. Das Haus, in dem sie gelebt hat, in der sogenannten Marinesiedlung, die vor dem Krieg für die Arbeiter einer Munitionsfabrik gebaut worden war, steht heute noch. Es steht leer, man könnte es für wenig Geld kaufen. Aber die Gemeinde Eschede ist hochverschuldet, hat das Geld dafür nicht. Und da bisher noch keine Tabori-Gesellschaft gegründet worden ist, was nahe läge, gibt es auch noch niemanden, der Interesse haben könnte, das Haus zu kaufen und zu renovieren.
Überlegungen in Eschede, Tabori für sein Engagement zum Ehrenbürger zu ernennen war eine der Initialzündungen für das vierte und letzte „Heide(n)spektakel“, das dann erst im Jahr 2000 stattfand. Die Information, dass Ursula Höpfner-Tabori in Eschede gelebt hat, war ein weiterer Impuls. 1996 und 1999 hatten wir je ein Kulturfest „hören & sehen“, auch mit anspruchsvollen Programmen – und dazwischen immer wieder einzelne Veranstaltungen aus allen Künsten, übers Jahr verteilt. Ein dritter Anstoß für ein weiteres „Heide(n)spektakel“ war die Weltausstellung „Expo“ in Hannover und in diesem Zusammenhang schon lange im Voraus das Bemühen des Landes Österreich um Kontakte für gemeinsame kulturelle Veranstaltungen im weiteren Umfeld der „Expo“. Ein glücklicher Zufall konfrontierte mich mit diesen Bemühungen und ermöglichte, auch finanziell, konkrete Überlegungen. Erstmals gaben wir dem „Heide(n)spektakel“ einen Untertitel: „Austria küsst Erika“. Damit war ein Österreich-Schwerpunkt gesetzt, der zu der skurrilen Situation führte, dass Künstler aus Österreich wissen wollten, wer denn Erika sei. Wir klärten auf, dass die in der Lüneburger Heide vom Spätsommer bis in den Herbst auf riesigen Flächen in verschiedenen Rotfarben blühenden Heidepflanzen auch Erika genannt werden…
MSE: Sehr clever. Erika als blühende Heide wäre mir auch kein Begriff gewesen. Wie entstand die Idee, Tabori als Ehrenbürger von Eschede im vierten „Heide(n)spektakel“ zu ernennen?
WK: Es gab bis dahin nur einen einzigen Ehrenbürger in Eschede, Heinrich Lange. Er war Bürgermeister des Ortes, als Tabori 1989 erstmals in Eschede war und dort seinen 75. Geburtstag feierte – Lange überreichte Tabori damals einen großen Topf Heidehonig. Und nun sollte Tabori der zweite Ehrenbürger des Ortes werden, das war die Idee von „Randlage Eschede“ und wurde von der Gemeinde unterstützt und getragen. Zielten die vergangenen Festivals mehr auf den die Sprachgrenzen erweiternden Arno Schmidt aus Bargfeld, stand nun der Grenzgänger zwischen den Literaturen, des Theaters und des Films, George Tabori, im Mittelpunkt, der ja auch eine Wiener Vergangenheit hatte. In der Johannis-Kirche in Eschede fand die Verleihung der Ehrenbürgerwürde statt – das Fernsehen hat in der ARD darüber berichtet. Stanley Walden, Komponist, Professor und Taboris musikalischer Begleiter und Freund zwischen Europa und Amerika hatte ihm ein Streichtrio komponiert, das das Österreichische Ensemble für Neue Musik aus Salzburg in der Kirche vortrug. Anschließend spielte und sang Walden, sich selbst am Flügel begleitend, die bekanntesten Songs und Musiken aus Taboris Stücken. Schauspieler, die mehrfach mit Tabori gearbeitet haben, Uschi Höpfner-Tabori, Leslie Malton, Charles Brauer, Hildegard Schmahl und Ignaz Kirchner, lasen ihm zu Ehren aus seinen Texten. In einem Mitternachtsgespräch, das im NDR gesendet wurde – über seine jüdische Biografie, sein Exil, das Schicksal seiner Familie, seine Zeit in den 30er Jahren in Berlin und wie er Hitler zugewunken hat, bedankte sich George Tabori auf seine Weise bei den Bürgern in Eschede für die Ehre, die ihm hier erwiesen wurde:
George Tabori:
“Ich war dreimal hier in Eschede. Wir haben auf dieser Bühne gespielt. Ich weiß nicht warum, ich kann es nicht erklären: fast überall fühle ich mich als Fremdling! Das klingt pathetisch, ist aber nicht so gemeint. Ich bin Mitte der dreißiger Jahre nach England gegangen und habe mich irgendwie entschieden, dass ich ein Fremdling bin. Wie viele meiner Kollegen; wie der James Joyce, der irische Schriftsteller, der in Triest gelebt hat; wie der Hemingway, der Amerikaner, der in Cuba lebte; wie der Georg Büchner, der in die Schweiz emigrierte - und diese Leute haben mich dazu gebracht, dass ich das Fremdsein nicht als Legitimation verstehe, aber doch empfinde. Ich bin überall fremd. Aber es gibt einige Orte, wo ich mich plötzlich, ich weiß nicht warum, ich kann es nicht erklären, zu Hause fühle. Wie in Eschede! Und dafür bin ich Ihnen dankbar.”
Wend Kässens:
Rundfunksendung im Jahr 2000 auf NDR Kultur
Das letzte „Heide(n)spektakel“ wurde mit der besten Bigband der Welt, dem „Vienna Art Orchestra“ und dem „Duke Ellington’s Sound of Love“ eröffnet. Der herausragende Karikaturist Österreichs, Gerhard Haderer, stellte seine bösen Cartoons und Karikaturen aus. Das Landestheater Linz spielte Thomas Bernhards Vor dem Ruhestand – ein bewusst gesetzter Spiegel für die Juristenstadt Celle, die lange mit der Nazivergangenheit zu ringen hatte. Das Burgtheater war mit Peter Fitz vertreten, der das Lebensdrama eines großen Künstlers in der Inszenierung von Hermann Beil vorführte, von Thomas Bernhard Beton – Ein Selbstgelächter. Aus Taboris Heimatstadt Budapest war das „Dresch-Quartett“ gekommen, Ungarns aufregendstes und bestes Jazzensemble. Eine Podiumsdiskussion über österreichische Lyrik, Mit diesem traurigen Land allein…fand sein Publikum. Zwischendurch spielte die Wiener Tschuschenkapelle auf. Daneben auch hier Lesungen und weitere Veranstaltungen. Österreichische Bauern verkauften Wein und Speck aus der Steiermark und verköstigten die Besucher aus ganz Deutschland. Ein Fest für Tabori, von Donnerstag bis Sonntag. Mit der Ehrenbürgerwürde war kostenfreies Wohnen und Essen in Eschede verbunden. Muss man sagen, dass Tabori davon niemals Gebrauch gemacht hat?
Vor der Windmühle in Eschede sind zwei Kanaldeckel in den Boden eingelassen mit den Namen und den in goldenem Metall eingelegten Unterschriften der beiden so ungleichen und sich doch in ihrer Menschenliebe ähnlichen Ehrenbürgern. Diese Idee stammt aus St. Louis in den USA, wo die Nobelpreisträger und großen Persönlichkeiten der Stadt auf diese Weise geehrte wurden und werden.
MSE: Die Kanaldeckel sind einzigartig und auch dauerhaft. Die aparte Idee hat Tabori sicher gefallen. Was bleibt in seinem Werk für uns heute bestehen? Anders gesagt, was schätzen Sie besonders an seinem Theater?
WK: Ja klar, der Kanaldeckel mit seiner faksimilierten Unterschrift war in Taboris Sinn. Die Person Tabori, seine Bücher und sein Theater waren zusammen ein Faszinosum, dem man sich nur schwer entziehen konnte. Mit seinem ersten, heftig umstrittenen Stück in Europa, Die Kannibalen, hat er sich an ein Thema gewagt, das noch niemand vor ihm auf die Bühne gebracht hat: Das Leben und den Tod im KZ. Das allein ist schon ungeheuerlich. Aber es kam noch etwas hinzu, das über das Tabu weit hinausreicht: Humor! Ein galliger, trotziger Humor! Das größte Leid, der qualvolle Tod in einer Menschenfresser-Farce ist vor Humor nicht gefeit. Seiner natürlich anspielungsreichen Erzählung „Mein Kampf“ setzt Tabori ein Zitat von Hölderlin voran: „Immer spielt ihr und scherzt? Ihr müsst! O Freunde! Mir geht dies / In die Seele, denn dies müssen Verzweifelte nur.“ Der Humor, der aus der Verzweiflung kommt über den Menschen als Mörder des Menschen. Diese Doppelbödigkeit, dieser Abgrund ist fast allen seinen Stücken eigen. Mancher Theaterabend endete im Eklat. Nicht alle Zuschauer haben diese für Tabori so typische Ambivalenz ertragen. Diese Mischung aus Groteske, Humor, Schrecken, der nichts Menschliches fremd ist und die auch keine Unmenschlichkeit ausblendet, rührt an Tabus! Verletzende Intimität gehört auch dazu! Anstößigkeit! Es ist eine Form des Theaters, die einen nicht kalt lässt, die in jeder Hinsicht zu erschüttern vermag. Es ist ein Theater, das vor Blut und Gewalt nicht zurückschreckt, aber auch genauso auch Liebe und Zärtlichkeit zeigt. Hier wird hemmungslos auf die Bühne gebracht, was unser Sein bestimmt, an unserer Existenz rührt. Wozu auch selbstverständlich Nacktheit gehört, Sexualität. Oder Behinderung. Peter Radtke, ein Krüppel mit der Glasknochenkrankheit im Rollstuhl, hat als Schauspieler in mehreren Inszenierungen Taboris wesentliche Rollen gespielt. Er hat über diese „Erfahrungen eines behinderten Schauspielers“ ein Buch verfasst: M wie Tabori. Der hat über ihn geschrieben: „Eine besondere Freude war es von Peter Radtke zu lernen. Sein Leben als Mensch, als Bürger und als Künstler war von jeher gefeit – eine Art heroisches Hindernisrennen – gegen unmögliche Übermacht. Bei der Geburt ein Haufen gebrochene Knochen, entging er, wie ich, den Übermenschen, die ihn packen und einschläfern – oder Schlimmeres – wollten. Die Gebrechlichkeit seines Fleisches beschämt unsere eigenen geringfügigen Behinderungen; er ist der lebendige Beweis dafür, dass das Fleisch zwar schwach, der Geist aber nicht nur stark ist, sondern dass dessen Kraft die tausend Gebrechen, ‚die unseres Fleisches Erbteil‘ sind, überwinden hilft. Zuweilen ist er uns zur Verkörperung des ‚Prinzips Hoffnung‘ geworden.“
Diese Sicht auf den Menschen und unsere Existenz kennt keine Tabu, an dem nicht zu rütteln ist. Das ist auch immer eine Attacke, ein Angriff auf das eigene Selbst, auf das, was man verdrängt hat oder nicht sehen will. Man wird durch dieses Theater buchstäblich getroffen. Eine Art Seelentherapie. Man geht danach nicht wie selbstverständlich zur Tagesordnung über. Das habe ich so gelegentlich nur bei Peter Brook noch erlebt. Im besten Fall kommt man aus einer solchen Aufführung als ein Anderer wieder raus.
MSE: Man wird mit sich selbst konfrontiert… Das ist nicht immer angenehm.
WK: Ja. Das Tabori-Theater war immer auch ein Theater der Peinlichkeit, der Intimität, weil er Dinge auf die Bühne bringt, zu denen die Leute sagen, muss ich mir das jetzt ansehen? Muss ich das jetzt ertragen? Ja, es ist ihnen peinlich, manche gehen, die meisten bleiben. Auch der Schauspieler, der das spielt, muss sich damit auseinandersetzen. Für George gehörte das zur Kreatürlichkeit des Menschen dazu. Er, der seinen Vater und den größten Teil seiner Verwandten im KZ verloren hat, konnte pauschalisierende Charakterisierungen nicht ertragen. Wenn in Diskussionen von den Juden oder den Nazis gesprochen wurde, unterbrach er harsch. „Ich kenne weder die Juden, noch die Nazis! Es gibt den Menschen nur als Individuum“ war ein klares Wort von George Tabori.
Man konnte so viel von ihm lernen! Ich lese, sehe, verstehe und empfinde sein Werk, diesen Berg aus Romanen, Erzählungen, Essays, Theaterstücken – und dazu die große Zahl von Inszenierungen als eine ganz besondere Form der Menschlichkeit, der Menschenliebe - und der Wiedergutmachung des Opfers am Täter. Auch das ist peinlich! Aber eine Peinlichkeit, die wir ertragen müssen, weil sie uns weiterhilft. Hier etwa liegt mein Interesse an der Gründung einer Tabori-Gesellschaft, einer Gesellschaft für jüdisch-deutsche Freundschaft in Zeiten von drastisch anwachsendem Antisemitismus.
MSE: Ich kann nur zustimmen. Herzlichen Dank, Herr Kässens.
Walter Kempowski
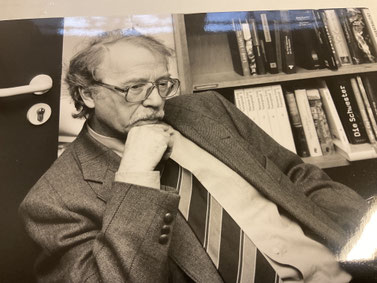
Walter Kempowski in meinem Arbeitszimmer im NDR.
Geb. am 29.4.1929 in Rostock, gest. am 5.10.2007 in Rotenburg/Wümme.
Begegnungen mit Walter Kempowski
Nartum ist wie ausgestorben an diesem warmen Sonntagmittag im Spätsommer. Der Wirt des Ristorante „Tiramisu“ sitzt schläfrig und allein auf der Terrasse an der Straße. Kunden sind weit und breit nicht in Sicht, das Lokal macht den Eindruck, als hätte es sich hierher verirrt. Auf dem Bauernhof daneben ein Schild „Neue Kartoffeln ohne Gülle zu verkaufen“. Alte Bauernhöfe aus dem 19. Jahrhundert dominieren das Dorf, die meisten in rotem Klinker und mit Spitzgiebel. Für schattige Plätze sorgen Ansammlungen von Eichen und anderen Bäumen entlang der Ortsdurchfahrt, sie geben dem Dorf ein gemütliches, leicht waldiges Ambiente. Auch der Sportplatz, gleich hinter dem Feuerwehrhaus, wirkt verlassen. Lediglich vor dem „Nartumer Hof“ stehen drei Autos, deren Besitzer vermutlich hier zu Mittag essen – und, wenn sie sich für Literatur interessieren, mal neugierig in die Wandvitrine blicken, in der Bücher und Fotos von Walter Kempowski ausgestellt sind. Solche Kleinstausstellungen als Hinweis auf den hier heimischen Schriftsteller gibt es auch im „Niedersachsenhof“ in Sick und im mondänen „Wachtelhof“ in Rotenburg, Zeichen der Verbundenheit mit dem Autor und des Autors mit der Region. Im „Nartumer Hof“ versammeln sich seit Jahren die Literaturinteressierten, die sich an offiziellen Besuchsnachmittagen zu einer Führung durch Kempowskis Haus und zu einer Lesung angemeldet haben. Hier im bürgerlich-ländlichen Gasthof bekommen sie eine Einführung in Leben und Werk, bevor man sich gemeinsam auf den kurzen Weg macht an den nördlichen Dorfrand, vorbei an zahlreichen Einfamilienhäusern mit aufgeputzen Vorgärten und bunten Blumenbeeten. Einige Straßen haben die Silbe „Berg“ im Namen, die Kempowskis wohnen in der Straße „Zum Röhrberg“, sie besitzen das letzte Haus vor dem freien Feld. Ein Berg ist hier eine Anhebung von nur wenigen Metern, es ist im Prinzip flach, ums Dorf Wiesen Felder, Hecken, und gelegentlich, wie in der nördlichen Verlängerung von Kempowskis Haus, Ansätze von Mischwald. Auf den Koppeln zahlreiche Pferde, auf den Weiden schwarzbunte Kühe. Der Mais steht hoch, die anderen Getreidesorten sind längst geerntet. Die Pendler haben es nicht weit, nach Bremen sind es gut 50 Kilometer, nach Rotenburg/Wümme knapp 20 und nach Zeven weniger als 10. In der Ferne hört man das Rauschen der Autobahn 1 von Bremen nach Hamburg, sie ist gut 2 Kilometer entfernt.
Von der Autobahn runter, links ab Richtung Zeven, dann nach wenigen hundert Metern erneut links durch das winzige, waldig-idyllische Dorf Bockel - schon ist man in Nartum. Hat man erst die Nase gerümpft ob des wenig einladenden Edeka-Geschäfts mit Imbiß am Ortseingang, entdeckt man rasch, dass Nartum ein schönes, weitgehend intaktes Dorf ist. Zum Haus Kreienhoop biegt man bald in eine kleine Straße rechts ab, folgt ihr an Höfen und Häusern vorbei, bis sie in einem Knick nach links führt – und sieht wenig später auf der rechten Seite hinter Bäumen und Sträuchern Haus Kreienhoop. Es heißt so nach dem Flurnamen, es steht auf dem Flurstück „Kreienhoop“, Walter Kempowski hat diesen Namen seinem Haus übertragen, in das die Familie im Jahr 1972 eingezogen ist. Schon vorher hatte man allerdings sieben Jahre in Nartum gewohnt, in der Lehrerwohnung an der damals neuen Schule.
Haus Kreienhoop ist ein Ereignis. Als Haus und als Grundstück. Gleich in der Einfahrt zum Hof links eine riesige Eiche, drumherum Rhododendren, Sträucher, Beete – die Einfahrt auch in ein Parkgelände, das genau jenen Grad von Verwunschenheit und Verkommenheit aufweist, der einen nur dezent durch menschliche Eingriffe gebändigten Naturpark mit Waldcharakter auszeichnet. Nordwestlich vom Haus stehen noch Sandkasten und Schaukel der seit Jahrzehnten erwachsenen Kinder Karl-Friedrich und Renate. Gleich daneben ein größeres Gatter, in dem drei Schafe Gras rupfen. Bemooste, fast zugewachsene Wege führen durchs Gelände, Linden, Buchen, diverse Nadelbäume und immer wieder Rhododendren. Eine verglaste Veranda in Längsrichtung des Hauses nach Norden wird durch eine schnurgerade, über den Köpfen fast zugewachsene Allee durch das ganze, leicht ansteigende Naturparkgelände in die Tiefe verlängert, dahinter das freie Feld. Hier kann man sich buchstäblich Arm in Arm ergehen und in Natur und Literatur schwelgen. Ums Haus herum, in seinen Ecken und Erkern, aber auch auf dem Gelände Sitzgelegenheiten, Kunst-Nischen mit Skulpturen und Amphoren, Beete. In einer Ecke des kleinen Wäldchens die irgendwann mal hierher transportierten Grabsteine der Großeltern. In einer anderen ein alter offener Schuppen mit Werkzeug. Das ganze Gelände ein locus amoenus, ein durch und durch sympathischer Ort, der zum Bleiben und Nachdenken reizt. Und rechts und links, jenseits der Bäume und des Unterholzes, der Blick ins Weite und ins Offene.
Den Kontakt zu Walter Kempowski und seiner Frau Hildegard gibt es seit Jahrzehnten. Wir haben zahlreiche Gespräche geführt, miteinander diskutiert, ich habe ihn in öffentlichen Lesungen moderiert. In den letzten Jahren wurden die Kontakte enger und freundschaftlicher, das Vertrauen wuchs, die Besuche in Nartum wurden selbstverständlicher – sie kamen zunehmend auch ohne Anlaß zustande. Meine Wertschätzung dieses Autors hat bei jeder neuen Beschäftigung mit seinem Werk immer noch zugenommen. Ich glaube erst in diesen Jahren ganz beurteilen zu können, was für eine großartige künstlerischen Potenz, was für eine fulminante schriftstellerische Leistung hinter seinem Werk steht. Neben der Literatur ist es übrigens das Thema Reformpädagogik, das uns beiden am Herzen liegt.
Im Frühjahr 2005 habe ich Walter Kempowski besucht, um mit ihm über den letzten Band des „Echolots“ ein Rundfunkgespräch zu führen. Es war ein Gespräch von seltener Intensität und großer Offenheit – es begann mit Fragen nach Haus Kreienhoop, schlug einen Bogen über Leben und Werk und kam dann zum letzten Echolot-Band „Abgesang 45“. Im Frühjahr 2006 hatte ich das Glück, anlässlich der Verleihung des Hoffmann von Fallersleben-Preises der Stadt Wolfsburg die Laudatio auf Kempowski halten zu dürfen. Im Sommer 2006 erfuhr Walter Kempowski, dass er an Krebs erkrankt ist; im Herbst 2006, dass der Krebs bereits Metastasen gestreut hat. Es folgten mehrere Operationen.
2007 dann traf ich ihn im Krankenhaus in Rotenburg, vom Krebs schon deutlich gezeichnet, aber interessiert an einem weiteren Rundfunkgespräch. Aus diesen drei Annäherungen ist dieses kleine Buch erwachsen. Es wurde noch mehrfach durch Nachfragen und ein weiteres Gespräch, nun wieder in Nartum, ergänzt. Und durch Fotos, die Manfred Rathgeber, ein Bekannter von mir noch aus gemeinsamen Schultagen an der reformpädagogischen Odenwaldschule vor mehr als 40 Jahren und heute ein Freund, während eines Gesprächs in Nartum aufgenommen hat. Wenige Tage vor seinem Tod bat er seine Frau, mit mir zu telefonieren. Er hatte die Korrekturfahnen des Buches gelesen,, und war nun mit seinen Äußerungen, auch über Kollegen, nicht mehr einverstanden.
Es ist der letzte Besuch vor seinem Tod. In Nartum treffe ich Hildegard Kempowski, Simone Neteler, die nach wie vor immer wieder nach Nartum kommt, um für Walter Kempowski Arbeiten zu erledigt, und die aus den USA angereiste Tochter Renate. Ihr Hund ist neurotisch, er bellt, wenn ich ihn anspreche. „Er will von Ihnen weder angeschaut noch angesprochen werden“, sagt sein Frauchen, „deshalb bellt er“. Ich gehe noch einmal durch das Unterholz des Parks, durch das Wäldchen, die Allee entlang auf das Haus zu, blicke zu den Schafen, die sich vor der Sonne in ihre Hütte zurückgezogen haben. Walter Kempowski hat sich wieder hingelegt, er hat die Nacht durch Simenon-Krimis gelesen, sagt seine Frau. Gemeinsam schauen wir uns das Bildmaterial für das geplante und dann doch verworfene Buch an und freuen uns über das süffisante Lächeln des Autors und seinen offenen Blick in die Welt. Vermutlich freut uns der Funke Lebensmut, der darin zu entdecken ist. Er hätte noch so viele Projekte zum Ende zu bringen!
Paul Nizon

Foto von der Gert- Jonke-Preisverleihung 2017 in Klagenfurt, v.l. Mag. Markus Malle, Landtagsabgeordneter, Paul Nizon, W.K. und Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz.

Aufnahme vom 15. September 2019 in Nizons Wohnung in Paris - gut drei Monate vor seinem 90. Geburtstag
Passagen der Laudatio auf Paul Nizon aus Anlaß der Verleihung des Gert-Jonke-Preises am 19. März 2017 in Klagenfurt
Der Dichter Paul Nizon – ein auch über Europas Grenzen hinaus anerkannter und bekannter Autor höchster Sprachkunst - steht bei Kritik und Lesern in einer widersprüchlichen und heterogenen Wahrnehmung. Der differenzierte Umgang mit komplexer Sprache gehört selten zum Mainstream. Der 87jährige Schweizer Paul Nizon, der seit 40 Jahren in Paris lebt, ist aber in Frankreich dennoch anerkannt und geschätzt, vielfach ausgezeichnet, u.a. schon 1988 als Chevalier des französischen Ordre des Arts et des Lettres gleichsam eingemeindet worden. Französische Intellektuelle und Wissenschaftler schreiben über Paul Nizon, setzen sich mit seinem Werk auseinander. Der französische Schriftsteller, Regisseur und Schauspieler Fréderic Beigbeder fordert für Paul Nizon den Nobelpreis.
Die Literaturkritik in Deutschland ist polarisiert. Man ist irritiert durch die enge Verbindung von Erzähl- und Sprachkunst, Essayistik und Reflexion, die in Frankreich eher üblich und für das Werk von Nizon stilbildend ist. Die einen werfen ihm vor, unpolitisch zu sein, beklagen seinen angeblichen Stoffmangel, unterstellen Wortverliebtheit, verweisen auf Erotizismen und Ich-Bezogenheit – und stören sich an der literarischen Unbedingtheit dieses Autors. Andere bewundern die große Eindringlichkeit seiner Wortschöpfungen und Bildfindungen, seine Neugier und poetische Kraft, die Vielschichtigkeit und Doppelbödigkeit seiner Texte, nennen die Inhalte seiner Bücher, die sich oft in Tag- und Nachtträumen offenbaren, ein Fest der Sprache.
Zwei Gewährsleute stehen hinter dem Werk von Paul Nizon: Der Schweizer Schriftsteller Robert Walser – und der Maler Vincent van Gogh, über den Nizon 1957 promovierte. „Was Walser anging“, so Nizon, „so zielte die frühe Ahnung dahin, daß man auch ohne Anliegen, Inhalte, ohne Botschaft, ja überhaupt ohne nennenswerte Thematik dennoch ein Schreibgeschäft betreiben und am Leben halten kann – mit nichts als Sprache. … In Vincents Fall wird dem schöpferischen Akt nicht weniger als Selbsterlösung, ja Selbsterschaffung zugemutet. Der Weg stellt sich in der Form eines langen Marsches dar. Er hat viele Stufen, er führt aus der Nacht an ein Licht; er wird mit dem eigenen Leben bezahlt. Dementsprechend der Werkbegriff: existentiell.“
Damit ist deutlich, daß auch Nizon sein Schreiben nicht als Erfindung und Entfaltung von Stoffen definiert. In seinem zweiten Buch, dem Roman „Canto“ von 1963, lesen wir auf die typische Frage an einen jungen Autor, „Was haben Sie zu sagen?“ - „Nichts, meines Wissens. Keine Meinung, kein Programm, kein Engagement, keine Geschichte, keine Fabel, keinen Faden. … Weder Lebens-, noch Schreibthema, bloß matière, die ich schreibend befestigen muß, damit etwas stehe, auf dem ich stehen kann.“ Die Absage an ein Schreiben auf der Basis einer Ambition. Der belgische Philosoph Philippe Deriviére bezeichnet dieses Schreiben in Analogie zum action painting der expressionistischen abstrakten Maler der USA als „Aktionsprosa“ – „eine Metamorphose des Körpers des Schriftstellers in einen schreibenden Körper“. Der Titel von Nizons Frankfurter Poetik-Vorlesungen lautet demgemäß: „Am Schreiben gehen“. Ein Schreiben also, das vom eigenen Lebens- und Erfahrungsprozess ausgeht als ein Sich-Aussetzen mit allen Sinnen, als ein existentielles Wahrnehmen der Welt, das zur Sprache drängt und dabei erst den Autor hervorbringt. „Ich bin ans Schreiben gekettet wie an ein Beatmungsgerät“, hat Nizon das mal genannt. „Bei mir ist das Glücksjagen ein Sprachsuchen, deshalb bleibt für andere wenig übrig“, sagt er lakonisch und meinte damit die Menschen seines nächsten Umfeldes. Er war dreimal verheiratet. In der Tat zieht sich das Motiv des unruhigen Unterwegsseins und, damit verbunden, des Scheiterns in den persönlichsten Beziehungen, durch das Werk. Die einzige Liebe, die schon sein Leben lang hält, ist die zur Sprache. Das war ein Problem für seine Frauen – und auch für ihn selbst! “ Eine „Sprachwanderung“ nennt Nizon seine literarische Herangehensweise. „Ich habe den Sexus in die deutsche Literatur eingeführt“, hat er mal gesagt. Denn Sexus und Eros sind seinen Büchern eingeschrieben.
„Am Schreiben gehen“ – darin steckt eine komplexe Wechselwirkung, eine enge Verknüpfung des Literarischen mit dem Existentiellen, der Sprache mit dem Leben – so daß die dabei entstehenden Dichtungen zwar als autobiografisch grundiert erkannt werden können, aber keinesfalls als Autobiografien zu lesen sind. Deriviére spricht vom Köder, der dem Leser „wie Fallen dargeboten (wird), wo sein Glaube an eine Romanwirklichkeit sich falschen Hoffnungen hingibt.“
Sprache ist auch Distanz. Sprache ist auch Verrückung. Zur Sprachkunst gehört die Ambivalenz, die irritierende Zweideutigkeit, mit der Nizon spielt wie kein zweiter. Das ist sehr französisch! Seit Rimbauds Satz „Ich ist ein anderer“ haben die französischen Sprachwissenschaftler und Philosophen, nicht zuletzt Roland Barthes oder Jaques Lacan, um nur zwei zu nennen, über das Ich und die Wirklichkeit nachgedacht. Nizon versucht in seinen Romanen und Erzählungen alles zu tilgen oder zu übermalen, was die eigene Biografie ins Spiel bringt. Dabei entstehen Fiktionen schönster Dichtkunst, die mitunter so aussehen, als seien sie dem eigenen Leben und Erleben ganz unmittelbar entsprungen. In Wirklichkeit ist es so: Nizons vollständige Identifikation mit der erfundenen Figur und sein dichterisches Vermögen der Übermalung machen es möglich, daß der Leser sich wie mit dem wirklichen Leben konfrontiert sieht und daraus im besten Fall selber Leben gewinnt. Daher ist Nizons literaturkritischer und von manchen als Anmaßung verstandener Satz zu verstehen: „Ich bin ein Sprachmensch, kein Inhalteverteiler.“ Als Sprachmensch legt er großen Wert darauf, daß sein Schreib-Ich nicht verwechselt wird mit seinem zivilen Ich. Die Ambivalenz des Ich stellt sowohl das Autoren-Ich wie auch das Ich der Person Nizon generell infrage. Nizon spielt mit der Fiktion, sie ist seine „Gehweise“. Der Spiegel, in dem er sich zur Kenntlichkeit verrückt. Oder, umgekehrt, unkenntlich macht. „Ich bin“ sagt er, „eigentlich meine eigene Fiktion, so wie meine Plätze, Lebensschauplätze und Paris fiktionale Räume meiner Existenz sind.“
Das ist eine deutliche Absage an Geschichtenerfinder, die noch an die zusammenfassende Darstellung der Wirklichkeit glauben, an verbindliche Werte und die moralischen Impulse ihrer Aussagen. Also eine Absage an die meisten Autorenkolleginnen und –kollegen schlechthin. Damit sitzt Nizon – zumindest in Deutschland – zwischen den Stühlen. Sein Anspruch, in die Phalanx jener Schriftsteller von europäischem Rang zu gehören, die die klassische Moderne und die Postmoderne als produktive, literarische Herausforderung mitbestimmt haben, ist nicht nur berechtigt, seine Bücher halten diesem Anspruch auch stand. Die Zahl seiner Literaturpreise ist dennoch überschaubar. Der Büchnerpreis, der diesem Dichter sicher zugestanden hätte, war nicht dabei. Immerhin hat man ihn spät in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen. Die Verletzung, die daraus erwächst, kompensiert Nizon in der Zuneigung zur französischen Hauptstadt und zu Frankreich.
Nizon ist ein großer Leser und passionierter Kinogänger. Wer sich mit seinen Büchern beschäftigt, begegnet fast allen bedeutenden Autoren der Moderne, von Beckett bis Joyce, von Hemingway bis Italo Svevo. Und genauso auch den herausragenden Filmemachern, von Fellini über John Cassavetes bis Claude Chabrol. Und natürlich, in Erinnerung an seinen früh verstorbenen Vater, die Russen: Von Isaak Babel über Tolstoi bis zu Vladimir Nabokov. Natürlich gibt es auch die beiden Schweizer Heroen Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt. Frisch hat Nizon an den Suhrkamp-Verlag vermittelt, Dürrenmatt ihn später einige Zeit unterstützt. In Nizons Journalen der Jahre 1961 bis 2010 in fünf Bänden – zugleich Stoff- und Gedankenspeicher, Werkstattbericht , autobiografische Notizen und Alltagsprotokoll - findet man zu Leben und Werk dieses Autors fast alles, was ihn beschäftigt.
Was war vor Paris? Paul Nizon, in Bern geboren, Sohn eines russischen Emigranten, eines Chemikers und Erfinders, und einer Bernerin, veröffentlichte 1959 erste Erzählungen unter dem Titel „Die gleitenden Plätze“. Zehn literarische Miniaturen, Prosaskizzen, dicht am lyrischen Sprechen. Für das zweite Buch, das 1963 erschien, der Roman „Canto“, wurde für Nizon der Autor von „Reise ans Ende der Nacht“, Louis-Ferdinand Céline, wichtig. Die Zeitung „Le Monde“ nannte „Canto“ einen „vulkanischen Antiroman“, ein „Kultbuch der Literatur“, das, wie Célines Roman, seiner Zeit voraus war. „Canto“ ist, nach einem Rom-Aufenthalt, ein mehrstimmiger Gesang auf Rom und das Leben, der scheiternde Versuch, in der traumhaften und in der wirklichen Annäherung an die Stadt die Gleichzeitigkeit von allem, das Tempo, die Hektik, das eigene Fühlen, Denken, Hören und Sehen unmittelbar in Sprache zu übersetzen, die überwältigende Bilderflut der Existenz in der Metropole. Ein solcher Roman muß seine Leser und seine Kritiker erst finden. Das hat ein paar Jahre gedauert! Für mich ein früher literarischer Höhepunkt. Ein Rom-Buch, wie es kein zweites gibt! Als Triptichon gebaut, zentral in der Mitte die Erinnerung des Helden an Kindheit und Jugend in Bern, an die Unbehaustheit und den Tod des Vaters, in dem sich die Unbehaustheit des Sohnes spiegelt. Der setzt Frau und Kind in der Vorstadt Roms ab und träumt und lebt, egozentrisch und losgelöst, den Traum von Eros und Sex. Dieser Kampf des „Hurenwirts“, wie das Ich des Romans sich selbst bezeichnet, mit der Liebe und den Windmühlenflügeln der Stadt macht ihn zum Schriftsteller.
Der Schweizer Schriftstellerkollege Hansjörg Schertenleib sah in Nizons Büchern die Neubuchstabierung der Welt. Mehr kann ein Dichter nicht wollen. Harmonie, die Vereinigung oder der Ausgleich der Gegensätze ist Nizons Sache nicht. Er eckt an! Die ernsthafte Beschäftigung mit seinem Werk, die auch die Beschäftigung mit der Frage ist „wie kann man leben, wie kann man lebendig bleiben“, stößt den Leser gelegentlich heftig an die Abgründe der je eigenen Existenz.
Acht Jahre nach „Canto“ erschien der nächste Prosaband, „Im Haus enden die Geschichten“. Das Haus ist für Nizon die Metapher für das Geschlossene, Begrenzte, Eingefahrene, Eingesperrte schlechthin. So hat Nizon seine Kindheit und Jugend rekonstruiert, mal wird aus der Perspektive des Kindes erzählt, mal kommt es selbst in den Blick. Es sind Begegnungen der Verstörung und Verletzung. „Das ganze Haus war Fellini“, hat Nizon später mal formuliert. Das Buch „Im Haus enden die Geschichten“ schrieb Nizon vorwiegend in London, wo er die Bekanntschaft mit Elias Canetti pflegte. Dem ist der nächste Roman, „Stolz“ gewidmet, der den Jahrzehnte zurückliegenden Zeitraum seiner ersten Ehe, des ersten Kindes, und der Arbeit an der Dissertation, über Vincent van Gogh, zurückgezogen in einem Bauernhof im Spessart, verarbeitet: Das Leben des Iwan Stolz von seiner Schulentlassung bis zu seinem selbstgewählten Tod mit 25 Jahren. „Stolz“ ist der einzige Roman Nizons in linearer Erzählweise, entstanden in bewußter Echohaltung zu Büchners Lenz. Dafür erhielt Nizon 1975 den Bremer Literaturpreis.
München, wo er zeitweise studierte, Aufenthalte in Rom, Barcelona, London, wo er Canetti kennenlernte, dann Paris – das sind die Etappen des Weges, die die Loslösung von der Enge des Elternhauses, von der Geburtsstadt Bern, letztlich von der Schweiz dokumentieren. Was bei Robert Walser das Spazieren, das Wandern, das ist bei Nizon das Streunen oder auch Marschieren, wenn die Ruhelosigkeit den Helden durch die Stadt treibt. Nur in der lebendigen Metropole ist für Nizon die Kluft zwischen Kunst und Leben zu ertragen und an ihrer Überwindung zu arbeiten. In Paris, alter Wunschtraum, persönlicher Mythos und Mythos vieler Künstler, Aufbruchsort van Goghs, Orwells, des jungen Hemingway, von Henry Miller, Joseph Roth oder Walter Benjamin – Wie sich in Nizons 2002 herausgekommenem Journal der Jahre 1961-1972, „Die Erstausgabe der Gefühle“, nachlesen läßt, hat er sich wiederholt mit Benjamin beschäftigt und die Nähe auf verschiedenen Ebenen erkannt – in der „Großschreibung der Kindheit“, wie es Nizon notierte, in „der Gabe der Verwunderung als Voraussetzung für den erstmaligen Blick“, „in der Bedeutung des Fremdling-Standes … für den schöpferischen Prozess“ – „und schließlich das Stichwort „STÄDTEBILDER: Ich bin ja auch Stadtnarr“ schrieb Nizon.
In Paris hat er in der Rue Simart im 18. Bezirk im „quartier couscous“ eine kleine, spießige Wohnung einer Tante geerbt. Das ist der Ausgangspunkt für den Roman „Das Jahr der Liebe“, von dem aus sich ein Dichter als Stadtschreiber und Flaneur auf die Suche nach sich selbst begibt. Dem an „Liebesvergiftung“ Leidenden sind Ehefrau und Liebschaft abhandengekommen, der Erzähler erinnert sich an den „jugendlichen Doppelgänger“ Stolz und dessen Ende. „Warmschreiben“ nennt Nizon das tägliche Notieren der Gänge, Begegnungen und Erinnerungen, der Assoziationen, Träume und Albträume, der Gespräche und Lektüren, das Erwandern, Erschnüffeln und Ertasten von Paris. Die Sehnsucht nach Liebe, Erotik und Sexualität, Hauptthemen auch dieses Romans, werden erneut auf Erlebnisse in der Jugend zurückgeführt. Manches kommt da aus dem Warteraum der Erinnerung und verdichtet sich zu Bildern einer Pubertät, die in der Einsamkeit des im Elternhaus sich selbst überlassenen Jungen erträumte und gelebte Gegenwelten hervortrieb. Auch dieser Roman besteht aus drei Teilen. Der Faszination des ersten Eindrucks von Paris mit Besuchen in Madame Julies „maison de rendez-vous“ folgt die Konfrontation mit den Ängsten des Ausgesetztseins und des Scheiterns. Der dritte Teil ist dem Aufbruch gewidmet, der aus der neuen Liebe erwächst. Der Marschierer in Paris fettet seine Koffer ein, eine Reise steht an, ein Neuanfang. „Das Jahr der Liebe“ wird von vielen als Höhepunkt von Nizons Werken gelesen.
1989 erschien der Band mit fünf Erzählungen „Im Bauch des Wals“. Nizon nennt sie „Caprichios“, virtuose literarische Musikstücke in freier Form. Jonas blieb ja nicht im Bauch des Wals, er wurde ausgespuckt und mußte sich in der Welt zurechtfinden. Es handelt sich bei den Erzählungen um eigenwillige, diskontinuierliche Lebensmelodien, in denen sich der Ich-Erzähler spiegelt.
Das letzte Buch, das hier erwähnt werden soll: „Das Fell der Forelle“ – 2005 erschienen. Ein kurzer Roman, eine Art Selbstgespräch als Kampf mit der Bodenlosigkeit, der Hysterie der Einsamkeit, wenn man so will: der Verrückung des Helden, dem auch hier die Liebste abhandengekommen ist und der nun verloren durch die Metropole Paris stolpert - es handelt sich dabei um einen Luftakrobaten namens Frank, aus dem berühmten Geschlecht der Stolp – wir erleben ihn bei seinen surrealen Luft-Kämpfen, in seinem Bemühen, die entglittene Forelle wieder einzufangen, wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen. Das gelingt ihm aber erst in dem Moment, in dem sich der Trapezkünstler für das Fliegen entscheidet – und nicht für das Aufgefangenwerden! „Aufgefangen wäre wie eingefangen“ ist einer der letzten Sätze in diesem wunderbar leichten, geistvoll philosophischem Roman voller Ironie und Witz, in dem einmal mehr Erzählung und Reflexion ineinanderfließen. Am Schluss also eine Apotheose der Freiheit, höchste literarische und artistische Kunst. Dafür scheint der Jonke-Preis wie gemacht!
Die hier genannten Bücher von Paul Nizon sind im Suhrkamp-Verlag in Berlin erschienen. Wer den Autor näher kennenlernen möchte, dem sei der im Innsbrucker Haymon-Verlag herausgekommene Band „Die Republik Nizon“ empfohlen, eine Biografie in Gesprächen mit Philippe Derivière, aus dem Französischen von Erich Wolfgang Skwara.
